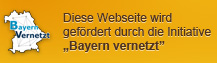Unsere Partizipation
Definition:
Unter Partizipation verstehen wir das Einbeziehen der Kinder in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse.
Regeln und Verhaltenskodex für die gesamte Einrichtung:
- In gewissen Situationen, z.B. bei Doktorspielen die Kinder beobachten und gegebenenfalls nach den Grenzen der Kinder fragen. (z.B. beim Spiel „Fieber messen“)
- Jedes Kind hat das Recht selbst zu entscheiden, wer ihm beim Toilettengang, Umziehen oder Wickeln begleiten und unterstützen darf.
- Hilfestellung beim Toilettengang: Das Kind entscheidet selbst, ob es Hilfe braucht oder nicht.
- Wenn Eltern Grenzen ziehen, müssen wir das akzeptieren (z.B. das Kind soll alleine auf die Toilette gehen). Wenn das Kind nicht damit einverstanden ist, wird es von uns akzeptiert und wir suchen das Gespräch mit den Eltern.